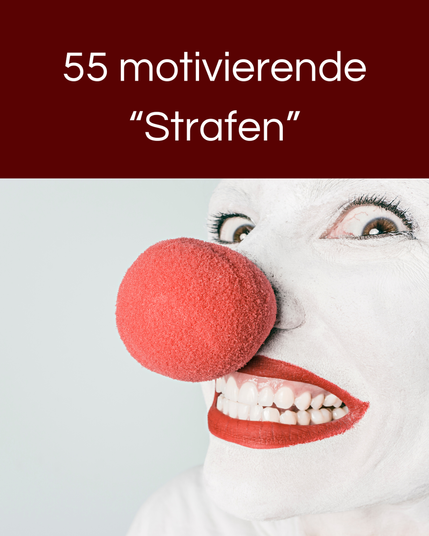Ungewöhnliche Bestrafungen führen dich zu mehr Freiheit, weil sie nicht auf Disziplin setzen, sondern auf deinen Spieltrieb. Und der hat am Ende mehr Power, als du denkst.
#SelbstSteuerung #MehrFreiheit
Read more 👉 https://astridengel.de/aussergewohnliche-bestrafungen-die/
Politik ohne Härten: Über fehlende gesellschaftliche Selbstregulation, über fehlende gesellschaftliche Disziplin
https://www.youtube.com/watch?v=pCKlxRJyGDw
#Politikversagen #PolitischesVersagen #Rentenpolitik #Prokrastination #Problemverschiebung #Selbststeuerung #NichtsMachen #Systemproblem #Verfassungsproblem #Reformbedarf #Handlungsfähigkeit #Politik
Politik ohne Härten: Über fehlende gesellschaftliche Selbstregulation, fehlende gesellsch. Disziplin
Das Stützrad-Paradoxon
beschreibt Strukturen, die aus guter Absicht heraus Lernprozesse nachhaltig in die falsche Richtung beeinflussen. Vorgegebene Lernwege ohne Gestaltungsfreiräume erweisen sich beispielsweise als Motivationskiller, denn:
„Der entscheidende Motivationsfaktor ist das Ausmaß der selbst erlebten Autonomie“
Michael Faulstich
Das Stützrad-Paradoxon ist das zentrale Bild für diese Strukturen. Es hilft uns, problematische Strukturen zu erkennen und nach Möglichkeit zu überwinden. Um das Bild zu verdeutlichen, gebe ich einen kleinen Einblick in meine Kindheit.
Meine kleine Schwester mit Stützrädern auf ihrem orangen Pucky
Ich hätte als großer Bruder nie gedacht, dass man ohne Stützräder Fahrrad fahren lernen kann. Meine kleine Schwester – fünf Jahre jünger als ich – hatte Stützräder an ihrem ersten Fahrrad. Die waren natürlich dazu da, dass sie alles lernen konnte: Treten, Lenken, die Verkehrsregeln; einfach alles, was sie aus meiner Sicht lernen sollte, bevor sie mit den Gefahren eines Sturzes konfrontiert werden durfte.
Jahre später haben mir junge Eltern erzählt, man nutze keine Stützräder mehr. Kinder würden neuerdings zuerst Laufrad fahren und könnten danach problemlos auf ein Fahrrad wechseln. Ich konnte es nicht glauben – das war doch viel zu gefährlich, das kann man Kindern doch nicht antun!
„Du lernst nicht zu laufen, indem du Regeln folgst. Du lernst es, indem du hinfällst.“
Richard Branson
Die pädagogische Perspektive: Warum Stützräder problematisch sind
Heute weiß ich, dass Laufräder wunderbar funktionieren, dass Stützräder nur eine trügerische Sicherheit bieten und wichtige Lernprozesse verhindern: „Sie verhindern sogar, dass Kinder das für das Radfahren richtige Lenken, Anfahren und Anhalten lernen.“ Als ich meine eigenen Kinder mit ihren Laufrädern flitzen sah, habe ich verstanden, dass genau dieses Ausprobieren von zentraler Bedeutung ist – und das Hinfallen auch!
„Fail early, fail often, but always fail forward!“
(John C. Maxwell)
Scheiter früh, scheiter oft, aber scheiter immer vorwärts!
Stützräder lenken den Lernprozess ungewollt in eine problematische Richtung: „Vor allem gewöhnen sich Kinder auf einem Kinderfahrrad mit Stützrädern eine falsche Kurvenfahrhaltung an: Sie verlagern ihr Gewicht nach außen statt nach innen. Sie machen also das genaue Gegenteil, so müssen sie – wenn die Stützräder abgeschraubt sind – das Kurvenfahren völlig neu lernen.“ Stützräder befördern also einen Lernprozess, der nicht nur ineffektiv oder suboptimal verläuft, sondern Kinder eher vom angestrebten Lernziel entfernt statt sich ihm zu nähern. Da Kinder sich die falsche Haltung angewöhnen, fahren sie oft nicht, sondern bleiben stehen. Mit der richtigen Haltung (und ohne Stützrad) lernen sie nachhaltig, wie diese Radfahrprozesse ablaufen: „Mit den Laufrädern lernen Kinder spielend ihr Gleichgewicht zu halten – das erleichtert ihnen später das Radfahren.“
Das Stützrad im Spannungsfeld des Lernens
Ich nenne dieses Phänomen das „Stützrad-Paradoxon“. Es steht sinnbildlich für problematische Strukturen, die im Rahmen von institutionalisierter Bildung entstehen. Dies fällt beispielsweise auf, wenn wir Lernprozesse ursprünglich denken und uns fragen, wie Menschen grundsätzlich lernen. Auf der einen Seite steht das systematische, institutionalisierte Lernen, wie wir es aus der Schule kennen, auf der anderen der Prototyp ursprünglichen Lernens, die Autodidaktik.
Autodidaktik als ursprüngliches Lernen
Ursprüngliches Lernen beobachten wir vor allem bei Kindern. Die allermeisten Kinder lernen selbstständig laufen und sprechen. Einige wachsen mehrsprachig auf, ohne dafür Sprachkurse zu besuchen.
Ebenso machte Paul McCartney als Musiker eine Weltkarriere, ohne Noten lesen zu können. Er hatte es nie gelernt. Bill Trayor begann mit 83 Jahren autodidaktisch sein Talent für Zeichnungen zu entwickeln. Das sind nur zwei Beispiele von vielen, die herausragende Fähigkeiten erlernt haben, ohne dass jemand anders sie gelehrt hätte.
Zur Ambivalenz der Didaktisierung
Auf der anderen Seite stehen systematisch-didaktisierte Unterrichtskonzepte. Natürlich sind diese sinnvoll: Es ergibt keinen Sinn, Unterricht unsystematisch zu planen. Auch unsere Lernerfahrung sagt uns, dass systematisches Lernen effektiv ist. So haben wir vermutlich alle Lehrerinnen und Lehrer im Kopf, die uns Klarheit verschafft haben, indem sie uns Struktur gegeben haben.
Andererseits führt das dazu, dass Schulen weitgehend lehrseitig gedacht sind, wie es Jöran Muuß-Merholz im Routenplaner#digitaleBildung auf der Basis einer Idee von Michael Schratz pointiert herausgearbeitet hat. Auch wenn wir so gern von Lehr-Lern-Prozessen reden, wird in der Schule der Stoff auf Pläne verteilt. Lernen wird auf dem Reißbrett geplant, beginnend in den Kultusministerien und den Landesschulbehörden, in den schulinternen Curricula und den Planungen der unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen. Wer nicht zur rechten Zeit das rechte lernt, baut Lernrückstände auf, liegt nicht im Soll.
Das führt zur Fremdbestimmung des Lernens. Sie geht einher mit fehlender Eigenverantwortung, da primär die Lehrenden Verantwortung für den Lernfortschritt tragen. Entsprechend fehlt die intrinsische Motivation, da Ziele nicht selbstgewählt sind, sondern – aus Lernersicht – angeordnet werden. Somit erreiche ich mit einer – gut gemeinten – systematischen Planung eine Entmündigung und Demotivation der Lernenden. Aus dem Wunsch, Lernen zu fördern, konstruieren wir Stützräder, die nicht zu Lern-Eigenständigkeit, sondern zu Lern-Abhängigkeit führen.
Co-Agency als Maßstab: Zwischen Lern-Eigenständigkeit und Lern-Abhängigkeit
Die OECD beschreibt in ihrem Lernkompass 2030 sehr treffend die Skala, auf der wir uns befinden: Oft wird beim eigenständigen Lernen konotiert, Lernende müssten das dann auch ganz alleine schaffen. Aber es geht nicht darum, Lernende sich selbst und ihrem Schicksal zu überlassen, sondern Ihnen die Initiative zu überlassen und aus dieser heraus gemeinsame Entscheidungen zu treffen -wie die 10 Stufen des Sonnenmodells der Co-Agency verdeutlichen: „Das Licht ist dort am hellsten, wo wir zusammen scheinen“!
Quelle:https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/OECD_Lernkompass_2030.pdf, S. 40
Projekt 2025: Prototypen für eigenständiges Lernen finden und sichtbar machen
Daher möchte ich in diesem Jahr die Laufräder, die Prototypen für eigenständiges Lernen finden. Bei mir selbst können Lernende vor allem in der Scrum-Variation und in Lesejournal- und Portfolioarbeit (Link) Verantwortung für ihr Lernen übernehmen, Lernprozesse selbst organisieren und reflektieren. Mein Ziele dahinter habe ich vor drei Jahren formuliert:
Quelle: Lernen 2021.Ein PodCast in Planung
Mein Ziel für 2025 ist, die Laufräder, die Prototypen, die positiven Beispiele für eigenständiges Lernen zu finden und in einem PodCast sichtbar, eigentlich eher hörbar zu machen. Wenn Du von einer Unterrichtsstunde oder einer Unterrichtssequenz berichten magst, in der Lernende eigenständig agieren konnten, melde Dich gerne bei mir. Noch bin ich in der Planung des PodCasts, aktuell suche ich gute Beispiele und Menschen, die davon berichten mögen.
cc by Niels Winkelmann
#eigenständigesLernen #eigenverantwortlichesLernen #Lesejournal #Selbststeuerung #Selbstwirksamkeit
"Wir müssen positive Emotionen sehr viel bewusster herstellen" #Selbststeuerung #Psychologie #Selbstverantwortung
https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2025/01/deutsche-gesellschaft-positive-psychologie-modrack-berlin-krisen.html
"Wir müssen positive Emotionen sehr viel bewusster herstellen"
Viele Menschen zieht die andauernde Sorge um die Weltlage runter - man würde gerne raus aus den negativen Gedanken. Wie das geht, und warum es auch wichtig ist, erklärt Mailin Modrack von der Deutschen Gesellschaft für Positive Psychologie.
Merker für mich:
Du sollst morgens keine E-Mails* lesen!
Starte in den Tag mit dem, was wirklich wichtig ist.
* Social Media, Nachrichten, Podcasts... alles lenkt nur ab und sorgt dafür, dass der Fokus aus dem Blick gerät. Ich werde fremd-gesteuert. Alles nicht gut.
WPK und Seminarfach als Labor für selbstgesteuertes Lernen
Wie und warum sich meine Schüler:innen eigene Ziele setzen und in eigenen Projekten realisieren – und warum die Reflexion dabei von zentraler Bedeutung für Selbstregulation ist. Eine Praxisbericht mit erklärenden Exkursen:
Meine Lernenden dürfen (und müssen) sich bei mir im WPK „Medien“ und im Seminarfach „Medien“ (Nds., 3. Halbjahr) eigene Ziele setzen. Mein Rahmen sieht lediglich vor, dass sie Medien, beispielsweise (fiktionale) Kurzfilme oder (sachorientierte) Nähvideos gestalten. Die Themen können im Schulkontext (z.B. Schülerzeitung, 360°-Rundgang durch unsere Schule oder Image-Video), aber auch in Themenfeldern verortet werde, zu denen meine Lernenden privat Bezüge haben. Daher habe ich einiges über K-Pop und Handball, Kochen und Nähen gelernt. Zudem habe ich Kurzfilme, voll-animierte Videos und selbstgestaltete Computerspielsequenzen zu sehen bekommen.
Vor allem durfte ich Lernende auf selbstgesteuerten Lernwegen begleiten. Sie haben Medien produziert, dabei viel über Medien gelernt – und die Arbeit reflektiert. Zugleich haben sie Projektmanagement geübt – und vor allem selbstorganisiertes Lernen praktiziert.
Die erste(n) Stunde(n)
Inhaltlich starte ich mit einer Mindmap zum Thema Medien (früher Flinga oder heute kits.blog). Leitfrage ist, welche Medien selbst erstellt werden könnten.
Dabei kommt schnell eine ansehnliche Sammlung zusammen, oft mit überraschenden und kreativen Ideen. Wichtig ist mir vor allem die Unterscheidung zwischen den verschiedenen traditionellen Medienformaten (z.B. Audio, Video, Print – die sich auf den in unserer Schule genutzten iPads verschiedenen Apps zuordnen lassen) und den Mischformen wie Ebooks und Social Media, die medial komplexer zu gestalten sind. Zudem betone ich die Unterscheidung zwischen sachorientierten oder fiktionalen Medien. Dazu bringe ich konkrete Vorschläge mit ein (z.B. Schülerzeitung oder 360°-Rundgang).
Die Schüler:innen haben dann die Aufgabe, sich ein Medium und ein Thema zu suchen. Dabei dürfen sie die Gruppen selbst bilden. Ich gebe als Orientierung eine ideale Gruppengröße von 3-5 Personen an, lasse aber auch größere Gruppen (je nach Thema und Medium) und Einzelarbeiten zu (je nach Persönlichkeiten, Themenwünschen und Medium). Meist dauert diese Phase bis in die zweite Doppelstunde, auch weil in der ersten Stunde immer wieder Schüler:innen fehlen.
Einführung in Projektmanagement und Kanban
Im Grunde ist diese Arbeitsform immer eine Einführung und Übung im Bereich Projektmanagement, was mir zugleich auch Monitoring und Steuerung der Lern- und Produktionsprozesse ermöglicht:
Anfangs informiere ich die Teams nur über den Ansatz, die Arbeit als Projektmanagement zu betrachten, und führe sie kurz in die Idee des Kanbanboards (zur Vorlage) ein, das ich dann für alle Teams als Kopie anlege. Im Seminarfach folgen in den nächsten Stunden kleine inhaltlich Inputs, da sich die Kurse das in den Abschlussreflexionen häufig gewünscht haben. Im WPK starte ich die Folgestunden mit inhaltlichen Impulsen (z.B. in den ersten Stunden mit Fokus auf die Zielformulierung, danach zu den Kanbanregeln, später zur Reflexion).
Entscheidend ist dabei, dass sie grundsätzliche Regeln von Zielsetzung, Kanban und Dokumentation respektieren. Alle Regeln sind auch in der digitalen Pinnwand erklärt:
Dadurch, dass alles auf dem Kanban-Board in Taskcard stattfindet, auf dem die Regeln abgebildet sind, ist die Einführung schnell gemacht und die Gruppen können die Regeln jederzeit nachlesen. Die Zugänge zu den Taskcards lassen sich schnell per Mail versenden.
Exkurs: Teamwork als Resonanz-Erfahrung
Dabei geht es aus Sicht der Schüler:innen anfangs vor allem um die Frage, wer mit wem was zu welchem Thema erstellen mag. Daher versuche ich in der Einführung alle drei Perspektiven zu betonen:
Letztlich ist die zentrale Frage häufig die dritte, eigentlich nach einem konkreten, s.m.a.r.t. formulierten Ziel. Oft genug finden sich Schüler:innen zusammen, die z.B. einen PodCast erstellen wollen, aber nahezu unvereinbare Vorstellungen von Form und Inhalt haben. Ebenso oft finden sich Cliquen zusammen, die Zeit miteinander verbringen wollen, sich aber weder auf Medium oder Format noch Inhalt einigen können. Daher ist die Phase, bis die Ziele ausformuliert sind, eine besonders heikle, in der auch Teams noch umbesetzt werden. Vor allem das Spannungsfeld im Akronym s.m.a.r.t. aus Akzeptanz und Realismus des Ziels muss in der Gruppe gut ausgelotet werden, damit die Motivationslagen nicht zu unterschiedlich sind und für das Team funktionieren. Wenn nur ein Teammitglied Lust auf das Thema hat, wird aus dem Team schnell ein T.e.a.m: Toll, ein anderer macht’s!
Aus Sicht von Hartmut Rosa gesprochen geht es um drei Resonanzachsen. Auf der vertikalen Resonanzachse liegt die Beziehung zur Welt, hier zum Thema oder Medium. Auf der horizontalen liegt die Beziehung zu den Mitmenschen, hier zum Team. Auf der diagonalen liegt die Beziehung zu Tätigkeiten, hier dem Produzieren. Barbara Hott nennt das sehr treffend „Werkstück“ (nachzuhören in Folge 127 von „Mein Scrum ist kaputt“). Wenn alle im Team Lust auf das Werkstück, das Produkt in seiner angedachten Form haben, kann das die Arbeit über ein halbes Jahr tragen.
Resonanz nach Hartmut Rosa, eigene Darstellung.Begleitung der Teams
Die Begleitung der Teams gestalte ich im wöchentlichen Lehrer-Team-Gespräch. Ich sehe mir mit jedem Team das Kanban an. So werden Fortschritte und Schwierigkeiten im Gespräch schnell deutlich und ich kann helfen, wenn Unklarheiten bestehen, z.B. Aufgaben nicht gut definiert oder verteilt sind. Durch regelmäßige Aktualisierung der Zielformulierung wird schnell klar, was als nächstes zu tun ist. Immer wieder müssen wir die Ziele auch anpassen. Diese Coaching-Rolle ist gut zu übernehmen und hochspannend, weil darin gelebte Förderung des selbstreulierten Lernens liegt:
Exkurs: Begleitung als Förderung des selbstreguliertes Lernens
Selbstreguliertes Lernen nach Anne Boekaerts, eigene DarstellungAnne Boekaerts hat ein Modell des selbstreguliertes Lernens entwickelt, in dem drei Schichten der Regulation miteinander interagieren. In den Projekten zeigt sich, dass eher selten die Regulation der Informationsverarbeitung im Fokus ist, da nur in wenigen Projekten eine intensive Phase der Verinnerlichung von Inhalt gefragt ist. Dafür steht die Regulation der Prozesse stark im Fokus, was mir als Lehrer besonders durch die Nutzung von Kanban eine Co-Regulation als Unterstützung ermöglicht.
Vor allem aber „ist die motivationale Komponente entscheidend für den gesamten Lernprozess. Dies trifft z. B. sowohl für die Formulierung von Zielen zu Beginn des Lernprozesses zu als auch für Handlungen zum Erreichen des Ziels (wie das Management der Ressourcen, die zur Zielerreichung benötigt werden).“ Das ist für mich das Herzstück dieser Kurse: Wenn Lernende die Erfahrung machen, dass sie sich selbst Ziele setzen und ihre Ressourcen selbst mitbestimmen können, sind sie mit Herzblut bei der Sache und investieren Zeit und Energie in einem Maße, was im Regelunterricht kaum zu beobachten ist. Insofern gibt es hier zwei neuralgische Punkte: Die Zielsetzung im Anfang und die Reflexion am Ende.
Ende der Projektphase/ Präsentation der Projekte
Das Ende der Projektphase kündige ich frühzeitig an. Außerdem plane ich rechtzeitig vor Notenschluss Zeit für die Präsentation der Projekte ein. Die Gruppen, die bereits fertig sind, bekommen so Feedback im Plenum von den Mitschüler:innen und mir.
Die anderen Gruppen haben noch Zeit, um nachzuarbeiten, und können bei der Präsentation etwas zum Arbeitsstand sagen. So können alle einen Einblick in die verschiedenen Medienprojekte bekommen.
Reflexion der Projekte
Die Reflexion der Projekte ist für mich von zentraler Bedeutung, da ich nicht nur das Endprodukt, sondern auch den Weg dorthin in den Fokus nehmen möchte. Daher sind entsprechende Reflexionen Teil der Bewertung (Die Vorlage gibt es hier als pdf oder doc).
Die Lernenden können die Reflexionen als Gruppe, aber auch einzeln abgeben, was aber meist nur erfolgt, wenn sich eine Gruppe uneins ist. Vorab habe ich bereits medien- und gruppenspezifische Hinweise für Reflexionen an jede Gruppe gegeben.
Die Bewertung erfolgte daher in der Zusammenschau von Lernprozess, Lernprodukt und Reflexion.
Erfahrungswert: Zusatzanforderungen im zweiten Halbjahr des WPK
Spannend ist die Reformation von Gruppen und Themen im WPK: Da Teamprozesse oft konfliktbehaftet sind (besonders da bin ich als Pädagoge gefragt, denn diese Konfliktaushandlungen bleiben im normalen Unterricht mit seinen kurzfristigen Gruppenarbeiten viel mehr im Untergrund) ist für Gruppen hier oft die Frage, ob sie in derselben oder in veränderter Konstellation weiterarbeiten. Das reflektiert unbewusst die Frage nach der sozialen Ebene der Gruppenarbeit, der Resonanz in der Gruppe, aber auch nach der Bereitschaft, sich auf eine mögliche Resonanz einzulassen.
Die Erfahrung zeigt, dass einige Gruppen zusammengeblieben sind und im zweiten Halbjahr an Projekten weitergearbeitet und sich aufgrund der eigenen Reflexion sowie meiner Hinweise methodisch einiges vorgenommen haben. So kann die Zusammenarbeit in einer größeren Gruppe, aber auch die Phasierung von Videos und Audios ebenso weiterentwickelt wie die Selbstorganisation mit dem Kanban. Besonders hierin besteht ein großer Reiz, da auf diese Weise die eigenständige Zielsetzung intensiviert wird.
Reflexion als zentrales Element für selbstgesteuertes Lernen
Diese Intensivierung lässt sich mit einer zweiten Perspektive auf selbstgesteuertes Lernen beschreiben. Für Barry Zimmermann teilt sich diese in die prä-aktionale Phase (Planung) , die aktionale (Durchführung) und die post-aktionale Phase: „Die letzte Phase beschäftigt sich mit der Reflexion des vorangegangenen Lernprozesses. Der Lernende überprüft in der postaktionalen Phase, ob das angestrebte Lernziel erreicht worden ist. Ist dies nicht der Fall, folgt eine Ergründung des Misserfolgs. Der Lernende schlussfolgert, ob dieser Misserfolg von der gewählten Lernstrategie oder dem zu hoch gesetzten Ziel abhängig ist. Nachdem die Optimierung stattgefunden hat, beginnt eine Rückkopplungsschleife, da die Bewertung in der postaktionalen Phase Einfluss auf die Planung der präaktionalen Phase einer folgenden Lerneinheit einnimmt.“
Entscheidend ist für mich, dass meine Lernenden in diesem Labor für Selbststeuerung immer wieder feststellen, dass diese Form von Projektmanagement (Ziele setzen, Aufgaben managen, reflektieren) ihnen auch in anderen Kontexten hilft – ob in schulischen oder privaten. Sie lernen zunehmend, Projektstrukturen in ihrem Leben zu erkennen und dafür die Muster aus dem Projektmanagement zu adaptieren und produktiv zu nutzen. Daher: Mehr Projekte, mehr Reflexion, für die mehr selbstgesteuerte (Persönlichkeits)Entwicklung!
cc by Niels Winkelmann
https://digilog.blog/2024/08/07/eigene-ziele-setzen-in-projekten/
#eigenständigesLernen #Persönlichkeitsbildung #Reflexion #Selbstreflexion #Selbststeuerung #Seminarfach #WPK
Womit wir beim Kern des Klimaproblems wären.
https://www.zeit.de/2023/46/klimapoltik-steuer-diesel-flugpreis-mehrwertsteuer
(unsere Regeln haben wir uns so gesetzt, dass sie uns unmittelbare Anreize zur Zerstörung derjenigen Umwelt geben, auf die wir angewiesen sind, um ein auch nur halbwegs angenehmes Leben auf diesem schönen kleinen blauen Planeten haben zu können)
#Gesetze #Regeln #Rahmenbedingungen #Selbststeuerung #Politik
@nielspflaeging
#Mehrwertige #Erlebnissituationen zu #meistern ist ein #Handlungsproblem, das #außerhalb #sozialer #Beobachtungsverhältnisse #gelöst ist. #Sozial fehlt es nicht an #Sprache, sondern an der #Umlenkung von #Unterscheidungen.
#Sprachlich könnten #Ebenen #interaktiv #übereinander gelegt werden durch #Zeichen,
was die #Affektreaktion von #Körpern leistet.
#Symbiotische #Mitwirkung des Körpers als #affektive #Selbststeuerung.
#Frage nach #Fall von #Abwesenheit und #Anonymität der #Körper.