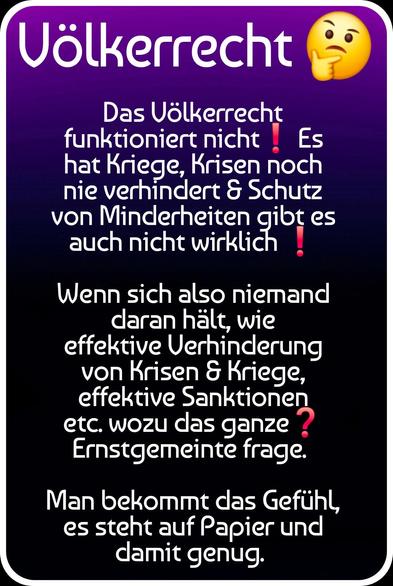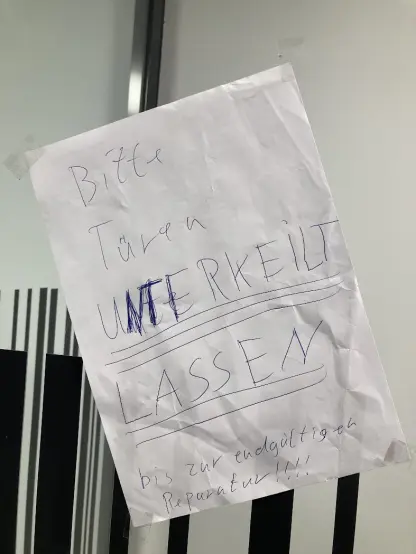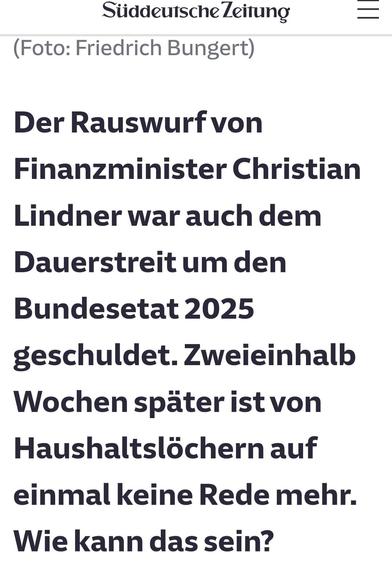Warum der Sommerinterview-Protest gegen Weidel genial funktioniert hat
1.330
Warum der Sommerinterview-Protest gegen Weidel genial funktioniert hat
von Thomas Laschyk | Juli 21, 2025 | Aktuelles
Gestern lief das ARD-Sommerinterview mit der Faschistin Alice Weidel. Und? Trendet eine der Lügen der Rechtsextremistin Alice Weidel? Diskutieren wir wieder, ob der Faschist Hitler ein „Kommunist“ sein soll oder so etwas? Diskutieren wir, ob es richtig ist, Millionen Menschen aus dem Land zu vertreiben? Nein – wir reden über den lauten, friedlichen Protest gegen sie, der das Gespräch buchstäblich übertönte. Damit war er jetzt bereits erfolgreicher im Kampf gegen rechtsextreme Propaganda, als es jeder pseudo-erlauchte Vorschlag derjenigen ist, die jetzt die Aktion kritisieren. Protest, der nicht stört, ist wirkungslos.
Der öffentlich-rechte Rundfunk sendet rechtsextreme Propaganda
Die Verantwortlichen der ARD haben sich schon wieder geweigert, auf den Stand der Wissenschaft und ihre Noch-Verteidiger zu hören, und haben die gesicherte Rechtsextremistin Alice Weidel ohne Not zum Sommerinterview eingeladen.wissenschaftlich fundiert, dass Interviews mit Extremisten diese stärken. Das sagen Experten seit Jahren. Das kritisiert der Deutsche Journalisten-Verband. „Entzauberung“ durch Frontal-Interviews ist ein Mythos. Irgendwie schadet das ständige Einladen der Rechtsextremisten der AfD doch offenbar auch nicht – im Gegenteil. Der ÖRR bleibt stur und schenkt den Demokratiefeinden von uns bezahlte, beste Sendezeit. Und arbeitet hart daran, neben den indoktrinierten Rechtsextremisten-Wählern auch noch diejenigen zu verlieren, die sie bisher stets verteidigt haben. Ohne erstere zurückzugewinnen, natürlich.
Dennoch durfte diejenige, die die Pressefreiheit der ARD bedroht wie kein anderer, ihre ständigen rechtsextremen Lügen vor laufender Kamera verbreiten. Doch der Plan der ARD für die kostenlose Propaganda-Stunde für Alice Weidel ging nicht auf – dank mutigem, demokratischem und friedlichen Protest: eine laute Demonstration auf der anderen Seite der Spree vom „Zentrum für Politische Schönheit“. Sie dröhnten unter anderem laut ein Lied mit dem Text „Scheiß AfD“ über Lautsprecher.
Weidel beklagte sich mehrfach beim Interviewer Markus Preiß darüber, dass sie ihn nicht richtig verstehen könne. Das sollte schon ein Indiz dafür sein, dass das eine gute Aktion war. Wer gerade trotz seiner verfassungsfeindlichen Ideologie von unseren Rundfunkgebühren bezahlte Sendezeit bekommt, kann sich wirklich nicht darüber beklagen, dass sie ihre Meinungsfreiheit eingeschränkt bekommt. Macht Weidel natürlich trotzdem, aber das sollte niemanden überraschen.
Freiheit ist, Rechtsextreme friedlich zu stören
An einem öffentlichen Raum friedlich zu protestieren, ist nicht nur okay, es ist unser demokratisches Recht. Gegen Alice Weidel, die AfD – und die ARD! – zu protestieren ist nicht nur demokratisch legitim. Erst recht gegen eine gesichert Rechtsextreme. Es war aber auch ein voller Erfolg. Die ARD hat es verbockt, weil sie ohne Not (Nein, sie muss sie nicht einladen!) eine Rechtsextremistin eingeladen hat. Letztlich liegt die Entscheidungsgewalt, die Programmautonomie, bei den Sendern selbst, die entscheiden, welchen Personen und Parteien sie wie viel Plattform einräumen. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2007 hervorgehoben:
„Die Entscheidung über die zur Erfüllung des Funktionsauftrags als nötig angesehenen Inhalte und Formen des Programms steht den Rundfunkanstalten zu. Eingeschlossen ist grundsätzlich auch die Entscheidung über die benötigte Zeit und damit auch über Anzahl und Umfang der erforderlichen Programme.“
Also die ARD hat sich ganz bewusst dazu entschieden. Und wie das abläuft haben wir schon dutzende Male gesehen: Die Faschisten lügen irgendetwas. Behaupten etwas Menschenverachtendes. Und wir empören uns, die Medien schreiben überall die Lügen ab (, auch wenn sie ihnen widersprechen wollen). Die AfD bekommt Aufmerksamkeit, Reichweite, Opferrolle. Und wieder mehr Legitimation. Den Faktencheck an einer anderen Stelle bekommt niemand mit. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben.
Die Tagesschau gibt doch zu, dass etliche Dinge, die Weidel sagte, gelogen waren. Schade, dass nicht die Fakten zur Primetime im Fernsehen liefen und nur die Lügen, nicht? Man kann niemanden „inhaltlich stellen“, der kein Interesse an Inhalten hat. Wir haben es doch gesehen: Selbst wenn eine Moderatorin glasklar live sagt, dass es gelogen ist, sagt Weidel einfach: Nein. Und fällt in die Opferrolle. Apropos.
„Opferrolle hilft der AfD“ rufen hilft der AfD
Die AfD könne sich jetzt als Opfer aufspielen und das würde ihr helfen, heißt es. Was? Die AfD spielt sich als Opfer auf? So wie … pausenlos? Egal, ob angebracht oder nicht? Die AfD wird sich dann auch als Opfer aufspielen, wenn sie an der Macht ist und alles gleichgeschaltet hat. Das macht ihr Vorbild Trump doch auch gerade und so viele Rechtsextremisten vor ihnen. Wer nicht möchte, dass die Faschisten Opfer sind, muss sie Täter werden lassen. Das ist eine defätistische Argumentation. Und sie ist auch falsch. Denn Weidel könnte sich viel besser als Opfer inszenieren, wenn sie in die größten Mikrofone des Landes sagen kann, dass sie ein Opfer sei.
Jede kritische Nachfrage würde ihr dabei helfen. Seid doch nicht so naiv, ihr seht doch, wie die Kommentarspalten aussehen. Gemeine Nachfragen oder die Existenz von Faktenchecks reichen doch schon. Oder will die ARD als Nächstes auch darauf verzichten? Wie viele Jahre wollen wir noch die exakt immer gleichen Fehler machen, bevor wir dazulernen? Wie realitätsverweigernd können die Verantwortlichen noch bleiben? Wenn man wohlwollend Unfähigkeit statt Mutwilligkeit unterstellt. Sie hat schon profitiert, indem sie eingeladen wurde. Das war die Schuld der ARD. Sie hat über Syrer gelogen, über die Klimakrise und vieles mehr. Weidel hat kein Recht darauf, vor Millionenpublikum die Öffentlichkeit anzulügen. Und das Sommerinterview zu protestieren, war nicht nur legitim, es war auch erfolgreich.
Sprechen wir über ihre Lügen? Nein
Was wäre denn die Alternative zu dem lauten Protest beim Sommerinterview gewesen? Nichts tun, zu Hause bleiben? Ohnmächtig auf Bluesky zu posten, dass die ARD einen Fehler macht? Das haben wir jetzt mehrere Jahre versucht und wir werden ignoriert. Muss man erst laut vor der ARD-Zentrale auftauchen, bevor Kritik gehört wird? Angriffe auf Journalisten haben sich mehr als verdoppelt. Wer diesen friedlichen Protest kritisiert, möchte, dass die Meinung einer Faschistin mehr Reichweite bekommt als der Protest der demokratischen Mehrheit. Falsche Neutralität hilft den Tätern. Wer die Demokratie nicht verteidigt, steht auf der Seite ihrer Feinde. Was? Wollen wir etwa, dass die Rechtsextremistin ihre demokratiefeindlichen Lügen deutlich und verständlich hätte äußern dürfen?
Fordern wir hier ernsthaft, dass rechtsextreme Propaganda nicht nur im Prime-TV ausgesendet werden muss, sondern die Lügen auch bitte laut und deutlich, damit sie auch ja jeder versteht? Spürt ihr euch noch? Das Bitterste ist ja, dass die Kritiker keine Alternative bieten außer dem, was die ganze Zeit schon schief läuft. Und naiv glauben, wenn man Rechtsextremisten zum hundertundersten Mal einlädt, dann klappt das dieses Mal bestimmt mit der Entzauberung.
Doch unabhängig vom Abstrakten sieht man doch deutlich, dass der Protest bereits funktioniert hat: Ich muss hier nicht wie jedes Mal, wenn die ARD einen Rechtsextremisten interviewt, einen Faktencheck machen und verzweifelt mit meiner Mini-Reichweite versuchen, die Lüge, die Millionen gehört haben, richtigzustellen. Denn wir sprechen nicht über diese oder jene Lüge der Faschistin Alice Weidel. Sondern über den Protest. Und jetzt ist es auch wieder nicht recht. Seht ihr denn nicht, dass er funktioniert hat? Er hat ihre Lügen aus dem Diskurs verdrängt. Was wollen wir denn mehr? Sie war live und ihre Lügen bekommen keine extra Aufmerksamkeit. Wenn jetzt auch Demokraten aber behaupten, das helfe der AfD, hilft das der AfD.
Die Alternative ist längst bekannt
Und ich bin ja nicht einmal jemand, der fordert, dass die Rechtsextremisten der AfD grundsätzlich nicht interviewt werden dürfen. Auch wenn sicherlich mir das viele unterstellen werden, weil der Diskurs in Social Media ohnehin tot ist, was auch Teil des Grundproblems ist, warum diese Interviews scheitern und Gegenrede und Faktenchecks sinnlos geworden sind. Das Sommerinterview wurde ja vorher aufgezeichnet: Zeit, um den Faktencheck zu machen und an entsprechender Stelle dann live im TV einzublenden. Weil die ARD das vor der Wahl in der Wahlarena nicht hinbekommen hat, haben wir das einmal selbst in die Hand genommen und mit dem gesamten Team 24 h fast pausenlos recherchiert:
Man könnte gemeinsam mit einem Experten die Ausschnitte diskutieren, vorher zu den entscheidenden Debattenpunkten Fakten einblenden, damit Zuschauer vorher wissen, was wahr ist. Man könnte in Ruhe verfassungsfeindliche oder falsche Aussagen einordnen. Dann hätte Alice Weidel ihr Interview – und nicht die Wirkkraft für ihre Propaganda. Dann wird sie natürlich auch meckern und jammern, aber wir haben doch schon etabliert, dass sie das IMMER tut. Aber nein, es gibt Watchparty auf Twitch mit einer Führerin einer Partei, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird.
Kann man übrigens mit allen Parteien machen, spricht natürlich nichts dagegen. Und wer meint, das ist zu aufwendig oder nicht verhältnismäßig: Dann dürft ihr eine Rechtsextremistin halt nicht einladen!
Protest, der nicht stört, ist wirkungslos
Die Idee ist doch nicht neu. Fordern wir seit Jahren, haben wir sogar einmal selbst vorgemacht. Worauf wartet ihr? Die ARD möchte aus „der Sendung Schlüsse ziehen und in Zukunft Vorkehrungen treffen“. Den Protest plant man auszublenden – aber nicht die rechtsextreme Propaganda? Warum will man nicht das Format endlich reformieren, anstatt Kritik daran zu unterdrücken?
Wenn die ARD sich weigert, aus ihren Fehlern zu lernen und wenn jetzt auch friedlicher und vor allem: effektiver Protest kritisiert wird, dann wissen wir, warum der Rechtsruck unaufhaltsam weitergeht: Weil unser mediales System und vor allem der ÖRR vollkommen unfähig ist, sich anzupassen. Und stur Kurs hält. Auf AfD-Machtergreifung. Darauf, dass die Rechtsextremisten die ARD abschalten? Pläne, die sie jetzt schon haben. Die ARD sägt nicht nur an ihrem eigenen Ast, sondern an dem, auf dem wir alle sitzen.
Solange man unseren Protest nicht hört – ihn sogar verteufelt – und sich mehr darüber aufregt, als dass eine Rechtsextremistin hier live Lügen verbreitet, benötigen wir mehr derartiger Aktionen. Wer leisen Protest will, will keinen Protest. Protest, der nicht stört, ist wirkungslos. Der Lärm beim Sommerinterview hat funktioniert.
Artikelbild: Screenshot https://www.tagesschau.de/thema/ard-sommerinterview
Passend dazu:
#funktioniert #gegen #genial #protest #sommerinterview #warum #weidel