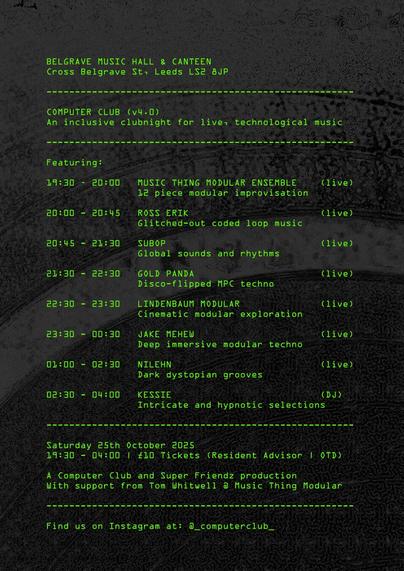"Die Annahme, die dissoziative Identitätsstörung werde letztlich durch Suggestion, Suggestibilität und Fantasiebegabung ausgelöst, wird von den wissenschaftlichen Fakten nicht gestützt. Erstens haben die Befürworter dieser Idee keine DIS-Patienten untersucht und zweitens zeigt sich kein Zusammenhang zwischen der DIS und hoher Fantasiebegabung (Nijenhuis & Reinders, 2012; Schlumpf et al.) oder Suggestibilität (Dalenberg et al., 2012). Die positive Korrelation zwischen dissoziativen Symptomen und berichteten negativen Erlebnissen bleibt auch dann bestehen, wenn die Fantasiebegabung kontrolliert wird (Dalenberg et al., 2012; Näring & Nijenhuis, 2005; Boom, Van den Hout & Huntjens, 2010). Es wurde auch festgestellt, dass der Einfluss, den die Fantasiebegabung auf die Korrelation zwischen dissoziativen Symptomen und berichteten negativen Erlebnissen hat, vernachlässigbar ist (Boom et al., 2010).
Drittens zeigen prospektive Längsschnittstudien, dass ein Zusammenhang zwischen frühkindlicher Traumatisierung und dissoziativen Symptomen besteht, die erst viele Jahre später auftreten (Diseth, 2006; Ogawa et al. 1997; Trickett, Noll & Putnam, 2011).
Diese Studien haben auch gezeigt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen desorganisierter Bindung und dissoziativen Symptomen, die zwei Jahrzehnte später auftreten (Dutra, Bureau, Holmes, Lyubchik & Lyons-Ruth, 2009; Ogawa et al., 1997).
Viele Praktiker, die glauben, es gäbe keine authentische DIS, haben (sogenannte) DIS-Patienten als Schwindler beschrieben oder als Opfer von gefährlichen Therapeuten, die suggestive Therapien anbieten. Abgesehen davon, dass die empfohlene Behandlung dieser Störung alles andere als suggestiv ist (z.B. Baars et al., 2011), wurden zudem handfeste Beweise dafür gefunden, dass die DIS eine authentische Störung ist, die im Zusammenhang mit Trauma steht, nicht mit Suggestion oder Fantasiebegabung. So zeigen zum Beispiel ANP und EP-Anteile [Anscheinend Normaler Persönlichkeitsanteil; Emotionaler Persönlichkeitsanteil] von DIS-Frauen sehr unterschiedliche psychophysische und neuronale Reaktionen auf Trauma-Skripte (Reinders et al., 2003, 2006). Kritische Kollegen schlossen daraus, dass hoch fantasiebegabte psychisch gesunde Frauen keine Schwierigkeiten hätten, verschiedene ANP- und EP-Anteile zu spielen und dann sehr ähnliche biologische Reaktionen zeigen würden - sie überprüften ihre These allerdings nicht. Wir konnten dagegen belegen, dass niedrig und hoch fantasiebegabte psychisch gesunde Frauen, die sorgfältig instruiert wurden und hoch motiviert waren ANP- und EP-Anteile zu simulieren, sehr andere psychophysische und neuronale Reaktionen zeigten (Reinders et al., 2012). In einer nächsten Studie demonstrierten wir, dass ANP- und EP-Anteile sehr unterschiedliche Reaktionen auf wütende und neutrale Gesichter zeigten, die unterhalb der Wahrnehmungsschwelle präsentiert wurden und dass selbst gute Schauspieler nicht in der Lage waren, diese Muster zu simulieren (Schlumpf et al, in Druck). Mittlerweile haben wir sogar Unterschiede zwischen Frauen mit DIS und Schauspielerinnen in der neuronalen Aktivität während des Ruhezustandes gefunden und auch zwischen ANP- und EP-Anteilen bei DIS Patientinnen (Schlumpf et al., in Vorb.).
Die negative Einstellung der #Psychiatrie gegenüber der DIS-Diagnose und den Therapeuten, die diese Störung behandeln, kann als eine Verschiebung von der scheinbaren Normalität (es gibt kein ernsthaftes Problem mit Kindheitstraumata, es gibt keine traumabedingte DIS) hin zu einer Kontrollposition gesehen werden. Patienten werden manchmal so dargestellt, als würden sie fabulieren oder lügen (so seien etwa ihre Erinnerungen an Kindheitstraumata meistens falsch). Und ihre Psychotherapeuten seien inkompetente Praktiker, die ihren Patienten die Störung und die Kindheitstraumata einredeten. Solche Patienten und Therapeuten würden den Menschen schaden, die zu Unrecht beschuldigt werden sowie deren Familien, außerdem der gesamten Psychiatrie und Psychologie und der Gesellschaft im Allgemeinen. Diese Individuen und Institutionen werden als Opfer der vermeintlichen DIS-Patienten und der Praktiker gesehen, die sie als DIS Fälle diagnostizieren und behandeln. In dieser Darstellung von Patienten und Therapeuten zeigt sich ein bemerkenswerter Aufwand, sie zu kontrollieren. Vor dem großen Mangel an wissenschaftlichen und klinischen Beweisen für die Annahme, die DIS sei, durch Suggestibilität, Fantasiebegabung und suggestive Therapie hergestellt und vor dem Hintergrund der klaren Belege, dass die DIS eine authentische psychische Störung ist, die kausal mit negativen eingebetteten Ereignissen in Zusammenhang steht, sind diese Kontrollversuche nicht gerechtfertigt, um mutmaßlich falsche Beschuldigungen zu vermeiden. Letztlich sind diese Kontrollversuche so gut wie nutzlos. Studien zeigen zum Beispiel, dass die Prävalenz von DIS in psychiatrischen Stichproben bei ungefähr 1 % liegt. Dieser Prozentsatz ist ähnlich hoch, wie der der Schizophrenie. Während die Datenbank PubMed auf das Stichwort Schizophrenie am 27. Juni 2013 103.829 Studien lieferte, wurden für das Stichwort dissoziative Identitätsstörung nur 329 Studien angezeigt. Gibt man beide Störungen in Kombination mit dem Suchbegriff neuroimaging [bildgebende Verfahren] ein, so gibt es 3343 Studien für Schizophrenie und nur armselige 9 für die DIS. Dieses große Desinteresse der Forschung an der DIS, scheint in engem Zusammenhang mit den finanziellen Interessen (keine Pharmafirma finanziert DIS-Studien), dem Stolz (wer will schon den Respekt seiner Kollegen verlieren, weil er DIS-Forschung macht?) und Vorurteilen zu stehen („Ist es nicht bewiesen, dass die #DIS mit Suggestibilität, Fantasiebegabung und dubiosen Psychotherapeuten zu tun hat, die selbst mehr als ein „ICH" haben?!"). Die Durchführung von bildgebenden Studien zur dissoziativen Identitätsstörung ist nicht empfehlenswert, wenn man Geld machen möchte, Anerkennung von Kollegen oder eine glatte wissenschaftliche Karriere anstrebt. Das gilt auch für andere DIS-Studien genauso wie für die Behandlung der schweren Dissoziation der Persönlichkeit."
-- Ellert Nijenhuis: Der widersprüchliche und inkompatible Wille bei Trauma. In: Verleumdung und Verrat. Ralf Vogt (Hg).