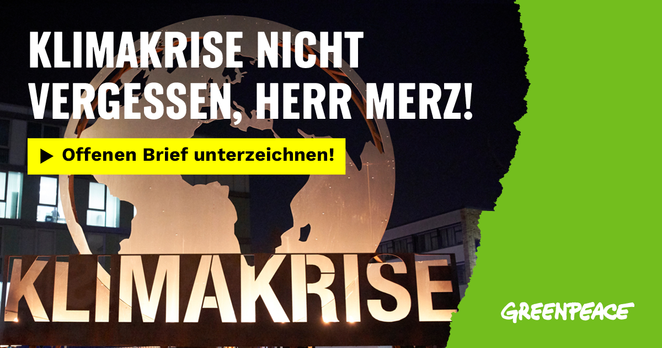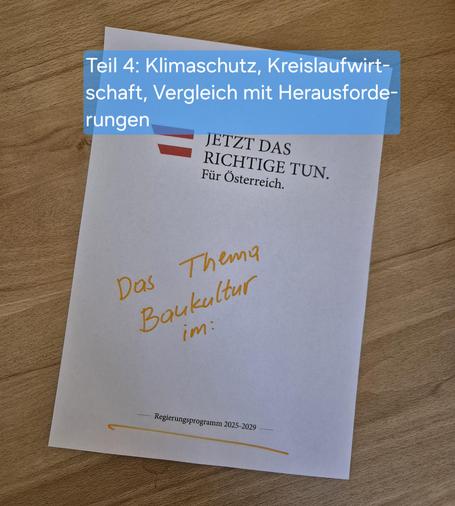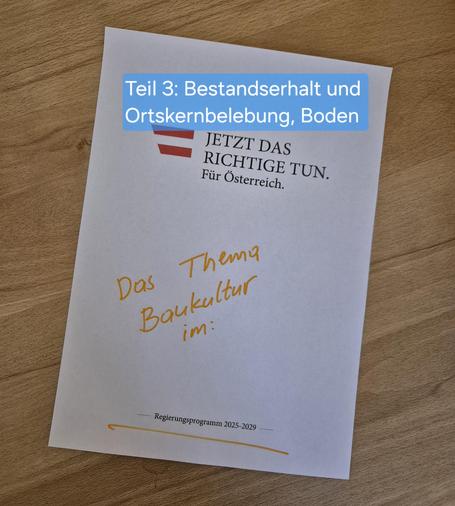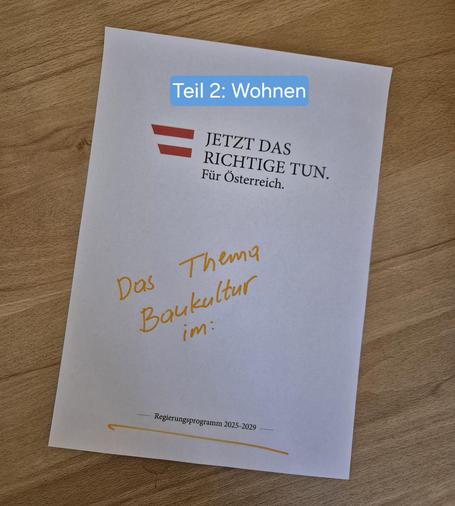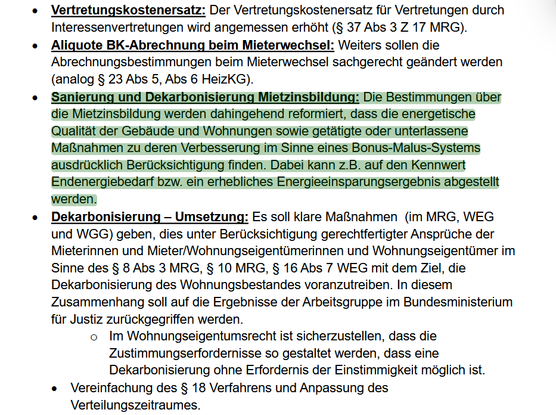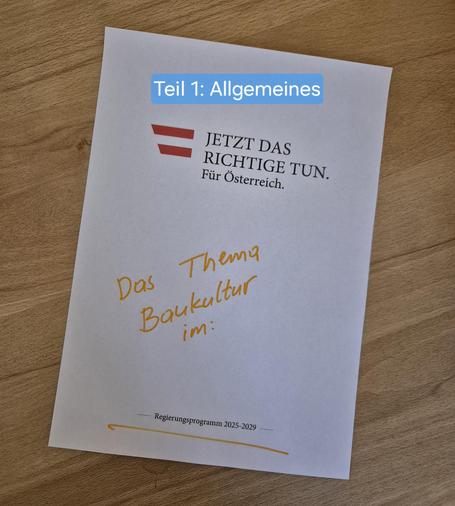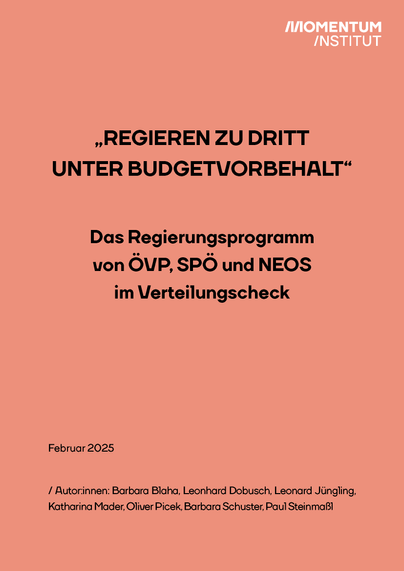#Baukultur im
#Regierungsprogramm 2025–2029: *Wohnen, Teil 2* (von 4)
Das Thema
#Wohnen nimmt einen prominenten Platz ein, und es gibt erstmals in Österreich ein Ministerium, das das Wohnen im Titel führt. Die Ansätze in diesem Bereich sind nicht schlecht, aber es bräuchte mehr. Die Regierung will die Baukonjunktur mit Fokus auf leistbaren
#Wohnbau stärken (wie?) und kostentreibende Anforderungen reduzieren, wobei Schutzstandards beibehalten sowie Regeln für das Bauen und Sanieren vereinfacht werden sollen; dazu zählt auch eine Klärung der Begriffe Regeln und Stand der Technik und eine Beschleunigung der Bauverfahren, zweifellos sinnvoll – das meiste davon ist aber Länderkompetenz. Die
#Wohnbauförderung soll wieder zweckgebunden werden, das war überfällig. Die AWS soll weiterentwickelt werden, um auch leistbares Wohnen zu fördern. Es sollen innovative und neue Baukonzepte ermöglicht werden, was auch immer das bedeuten mag. Hinsichtlich eines generationengerechten Zusammenlebens sollen „Projekte zu gemeinsamem Wohnen“ bundesweit gefördert werden. Eine Studierendenheimförderung soll wiedereingeführt werden.
Eigentumserwerb ist natürlich auch wieder mit dabei – dagegen ist grundsätzlich nichts zu sagen, aber es gibt 2 wichtige Grenzen: Es sollte nicht weiter die ohnehin schon enorme Zahl von 1,5 Mio. Einfamilienhäusern in Österreich gesteigert werden; und Wohnbauförderungsmittel sollten für langfristig leistbare Wohnungen und nicht für privaten Kapitalaufbau eingesetzt werden. Geplant ist ein Wohnbaukreditprogramm für junge Menschen, bei dem unklar ist, wie die Rahmenbedingungen aussehen; und ein Ansparmodell für den gemeinnützigen Wohnbau, das leider wieder öffentliches Geld privatisiert, immerhin freiwillig für die Bauträger. Gut ist es, dass ausfinanzierte gemeinnützige Wohnungen vorrangig für Menschen mit niedrigem Einkommen genützt werden sollen. Die energetische Qualität eines Wohnbaus soll im Sinne eines Bonus-Malus-Systems in die Mietzinsbildung einfließen, Zustimmungserfordernisse für Dekarbonisierungsmaßnahmen sollen erleichtert werden, für die Teilung von Sanierungskosten sollen „faire Lösungen“ gefunden werden. Befristete Mietverträge müssen zukünftig mindestens 5 Jahre laufen, das geht in die richtige Richtung, aber Befristungen müssten stärker eingeschränkt werden. Für die Indexierung von Mieten wird ein eigener Wohnraumindex geschaffen, der bei hoher Inflation unter dem VPI liegt, 2025–27 wird die Indexierung ausgesetzt bzw. begrenzt. Interessant könnte das geplante Gremium für das Wohn- und Immobilienwesen sein, wenn es als entsprechend transparente und demokratische Plattform des Austauschs und der gemeinsamen Entwicklung aufgesetzt wird und nicht hinter verschlossenen Türen agiert. Zur Qualität des (gemeinnützigen) Wohnbaus findet man wenig. (Fortsetzung zu Bestandserhalt und Ortskernbelebung, Boden, Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft, Vergleich mit den baukulturpolitischen Herausforderungen folgt ab morgen.)