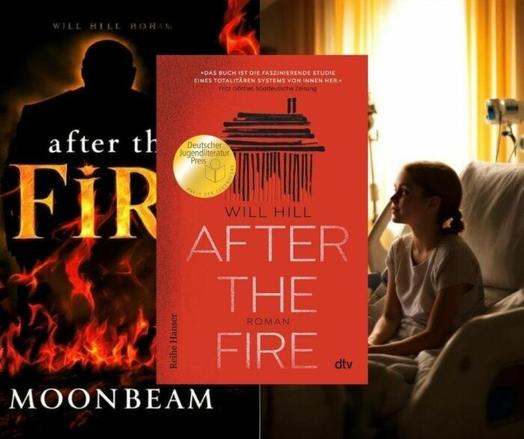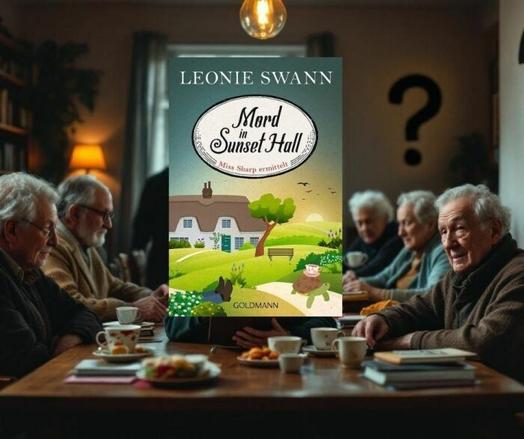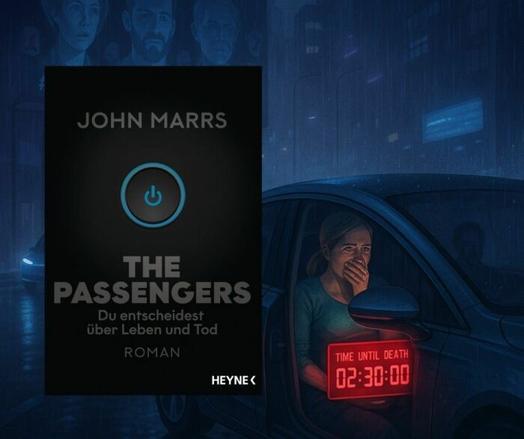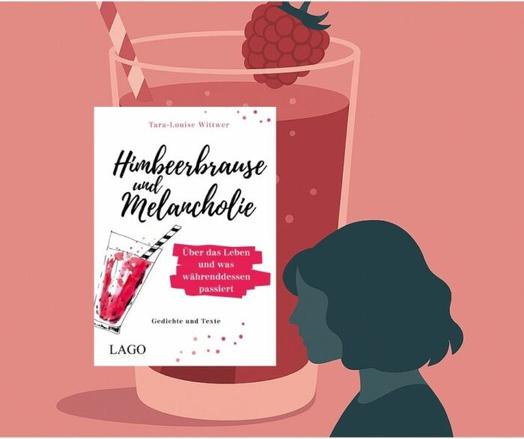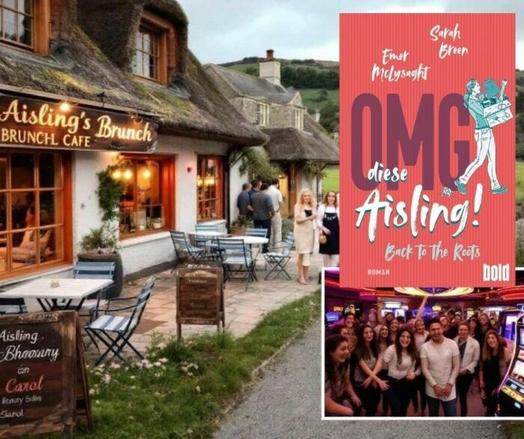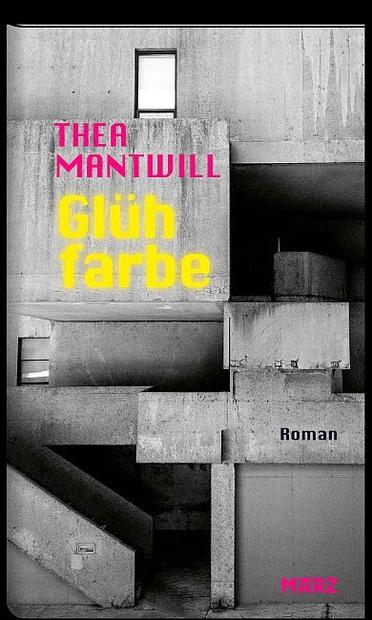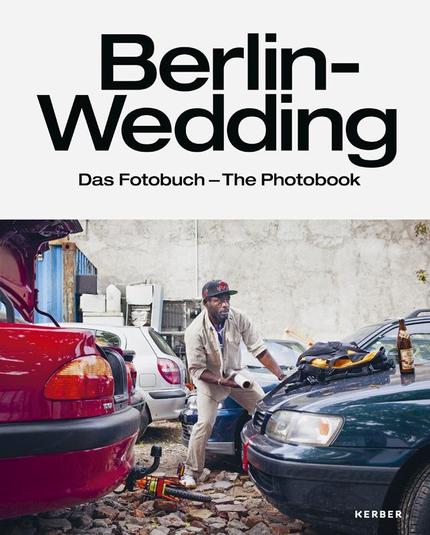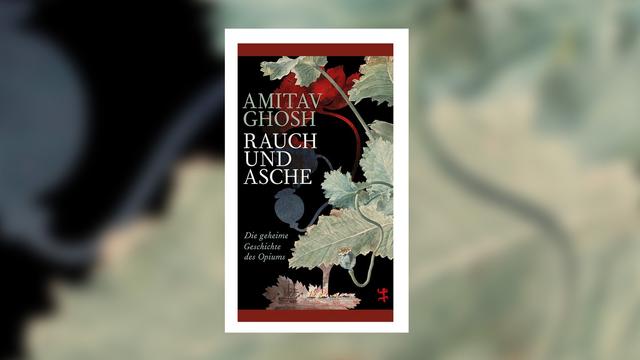LITL737 [Podcast] Literaturlounge: Will Hill – After the Fire – Mehr als nur ein Jugendbuch
In dieser Episode widme ich mich der Rezension von „After the Fire“, einem packenden Buch von Will Hill.
#AfterTheFire #Buchkritik #Buchrezension #DtvVerlag #Jugendbuch #Jugendroman #Literaturlounge #Literaturpodcast #Manipulation #Missbrauch #Podcast #Psychodrama #ReligiöserFanatismus #Rezension #Sektenausstieg #Sektenroman #Trauma #WillHill