Entfristungsgebot = Beschäftigungsverbot? Warum wir die Universitäten nicht aus der Pflicht entlassen sollten
In ihrer Kolumne zu den „Kosten zweckwidrigen Rechts am Beispiel des WissZeitVG“ kritisiert Marietta Auer die Bemühungen um eine Beschränkung der Befristung im Wissenschaftsbetrieb. Mit Verweis auf ihre eigenen Erfahrungen stellt sie fest, nicht Befristung der Beschäftigungsverhältnisse habe ihre Situation als Wissenschaftlerin prekär gemacht, sondern das „Damoklesschwert[s] der zwölfjährigen Höchstfrist nach dem WissZeitVG, nach deren Ablauf man sang- und klanglos aus der Universität hinausgeworfen wird, egal was man bis dahin in der Wissenschaft geleistet hat …“ (Auer 2025: 52). Auer greift eine durchaus verbreitete Metapher auf, wenn sie die durch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) festlegte Höchstbefristungsdauer als „ein faktisches Berufsverbot für Nachwuchswissenschaftler“ beschreibt. (Auer 2025: 53).
Alle Bemühungen um eine stärkere Einschränkung der Befristung sieht sie vor diesem Hintergrund nur als ein näheres Heranrücken dieses „Damoklesschwerts“ des „Beschäftigungsverbots“. Dementsprechend lehnt sie die Bemühungen von Initiativen wie #IchBinHanna als ein Lobbying in die falsche Richtung ab. Und in gewisser Weise geben ihr dir Auseinandersetzung um die Novelle des WissZeitVG von 2024 recht. Die dort umgesetzte Verkürzung der unbedingten Höchstbefristungsdauer nach der Promotion von sechs auf vier Jahren wurde weitgehend genauso diskutiert: als ein erzwungener Rauswurf nach vier Jahren. Und manche*r der oder die sich zuvor gegen Befristung eingesetzt hatte, forderte nun ein, die Möglichkeit einer längeren Befristung aufrecht zu erhalten.
Ich halte Auers Position dennoch für falsch. Denn die Rede vom „Berufsverbot“ naturalisiert in gewisser Weise eine eingeübte, aber keineswegs notwendige Haltung in den Personalabteilungen so gut wie aller Hochschulen. Jede auch nur im Ansatz mögliche entfristete Beschäftigung soll mit aller Macht zu verhindert werden, als drohe der unmittelbare Ruin. Aber natürlich haben Universitäten die Möglichkeit, mehr Stellen zu entfristen. Und genau das ist ja das Ziel entsprechender Initiativen. Dass aber, solange die Universitäten kein Millimeter von ihrer Null-Entfristungs-Praxis abweichen, jegliche Beschränkung der Befristungsdauer zu absurden Situationen führt, ist in gewisser Weise notwendige Folge eines jeden regulierenden Gesetzes. Dies dann aber automatisch als Grund zu nehmen, Einschränkungen der Befristungsmöglichkeiten zurückzunehmen, wäre allerdings seinerseits absurd. Man stelle sich vor, ein beliebiges Unternehmen forderte die Rücknahme der Höchstbefristungsdauer von zwei Jahren, weil das Auswechseln der gesamten Belegschaft alle zwei Jahre nicht förderlich für es sei.
Vielleicht verweist die von Auer richtig beschriebene Situation aber durchaus darauf, dass der Kampf um bessere Arbeitsbedingungen verstärkt in den Hochschulen selbst geführt werden muss – als ein Kampf nicht nur die Befristungsspielräume auszuschöpfen, wie es bisher geschieht, sondern auch die Entfristungsspielräume. Die Initiative Uni Kassel Unbefristet hat hier in der Vergangenheit bereits viel bewegt und Prozesse auch über Kassel hinaus angestoßen.
Zweifelsohne bieten Entfristungen innerhalb bestehender Strukturen aber auch viel Konfliktpotenzial. So kann es zu Reibungen mit dem Anspruch von Professor*innen kommen, Personal ohne „Altlasten“ neu zu bestücken und auszuwechseln. Vermutlich wird spätestens in diesem Zusammenhang irgendwann auch wieder die „Wissenschaftsfreiheit“ in Stellung gebracht. Letztlich wird eine nachhaltige Entfristungsstrategie so vermutlich nur zusammen mit einer Enthierarchisierung der Fakultäten möglich sein. Auch hier hat bereits eine umfassende Diskussion stattgefunden, etwa mit dem von der Jungen Akademie vorgeschlagenen Departmentmodell. Damit einher geht auch, dass Personalentwicklung, die an Hochschulen bis heute weitgehend inexistent ist, zu einem wichtigen Thema wird. Wenn man junge Wissenschaftler*innen nicht eh wieder nach drei Jahren loswird, muss man sich halt überlegen, wie sie in eine strategische Entwicklung von Instituten und Fakultäten eingebunden werden können, und welche Weiterqualifizierungsmöglichkeiten ihnen etwa auch ermöglicht werden sollten.
In gewisser Weise würde damit eine Normalisierung der Universität und ihrem Umgang mit Befristungen stattfinden. Dabei mögen Universitäten am Ende immer noch besondere Unternehmen bleiben, mit einem höheren „Zirkulation“ von Mitarbeiter*innen. Aber auch hier sind die Interessen der Organisation mit den sozialen Rechten der Mitarbeiter*innen abzuwägen – selbst wenn der hehre Zweck der Organisation „Wissenschaft“ ist.
Auer, Marietta 2025: Die Kosten zweckwidrigen Rechts am Beispiel des WissZeitVG, Merkur, 79, 915, S. 49–58.
#IchBinHanna #Befristung #Departmentmodell #WissZeitVG

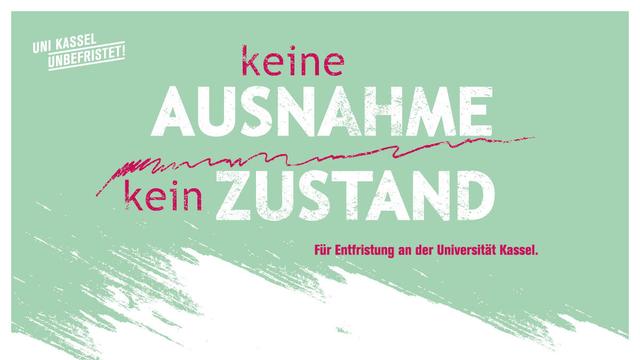

 🇺🇳🖖
🇺🇳🖖