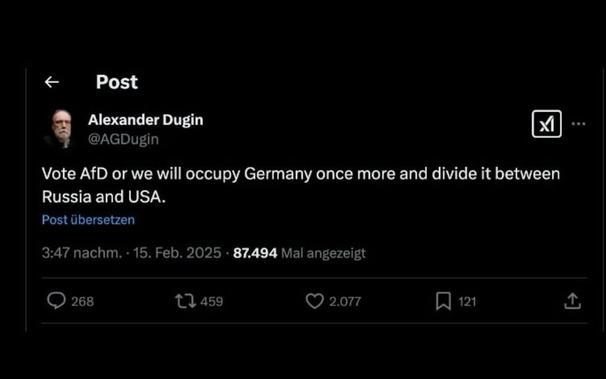Neues aus dem Fernsehrat (110): Öffentlich-rechtliche und private Medien zwischen Wettbewerb und Kooperation
Dieser Artikel stammt von Netzpolitik.org.
Neues aus dem Fernsehrat (110): Öffentlich-rechtliche und private Medien zwischen Wettbewerb und Kooperation
Private und öffentlich-rechtliche Medien stehen unter Druck – nicht nur durch Big Tech, sondern auch weil überholte Wettbewerbslogiken das wechselseitige Verhältnis prägen. Dabei gibt es im digitalen Raum Potenziale für Kooperation, die gerade wegen jeweils unterschiedlicher Logiken möglich sind.
24.03.2025 um 19:04 Uhr
–
Leonhard Dobusch, Christopher Buschow – in
Öffentlichkeit –
keine Ergänzungen Kooperativen Potenziale zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Medien ergeben sich gerade aus einer Zusammenarbeit unter Beibehaltung unterschiedlicher Logiken
– CC-BY 4.0 Die Serie „Neues aus dem Fernsehrat“ beleuchtet seit dem Jahr 2016 die digitale Transformation öffentlich-rechtlicher Medien. Hier entlang zu allen Beiträgen der Reihe.
Die duale Medienordnung in Deutschland ist in der Vergangenheit bewusst als ein wettbewerbliches Nebeneinander von privat-kommerziellen und öffentlich-rechtlichen Medien ausgestaltet worden. Mit dieser auch kartell- und wettbewerbsrechtlich verankerten Struktur wurde das Ziel verbunden, die grundlegenden Voraussetzungen für eine vielfältige und pluralistische Medienlandschaft zu schaffen (Gostomzyk et al., 2019, S. 4).
Dem Prinzip der strukturellen Diversifikation folgend, sollten private und öffentlich-rechtliche Medien sich insofern ergänzen, als dass sie wechselseitig die Schwächen des jeweils anderen kompensieren (Hoffmann-Riem, 2000, S. 34). Doch angesichts der tiefgreifenden Veränderungen, die eine digitalisierte und globalisierte Medienwelt mit sich gebracht hat, ist fraglich, ob ein ganz wesentlich auf Wettbewerb ausgelegtes Mediensystem heute noch zeitgemäß ist – oder ob es vielmehr einer kooperationsorientierten Neuordnung bedarf, um den gegenwärtigen Herausforderungen gerecht zu werden (vgl. auch Gostomzyk et al., 2021).
Der traditionelle Wettbewerb innerhalb der dualen Medienordnung erscheint heute wie ein Kräftemessen im Kleinen, während einige wenige, aber sehr dominante Plattformkonzerne die etablierten Medien – sowohl private als auch öffentlich-rechtliche Anbieter – in die Rolle bloßer Zulieferer für ihre Plattformen drängen (vgl. Andree, 2023). Jedoch haben die tiefgreifenden Umbrüche auf den Werbe- und Nutzermärkten die ohnehin bestehenden Spannungen nochmals verschärft.
Besonders anschaulich zeigt sich diese konfliktreiche Auseinandersetzung in den jüngsten, hitzig geführten Debatten um eine vermeintliche „Presseähnlichkeit“ öffentlich-rechtlicher Online-Angebote, die in Konkurrenz treten würden zu privatwirtschaftlich organisierten Medien. Auch wenn der empirische Forschungsstand zu diesem Thema bislang unzureichend ist, deuten jüngste Studien doch darauf hin, dass die Annahme einer signifikanten Wettbewerbsverzerrung durch die öffentlich-rechtlichen Medien nicht haltbar ist (Sehl et al., 2020; Udris et al., 2024; Zabel et al., 2024).
Das eigentliche Problem liegt unseres Erachtens auch vielmehr in der zugrundeliegenden Denkweise, also in der unnötigen Frontstellung zwischen den tragenden Akteuren der dualen Medienordnung. Aus unserer Sicht versperrt diese den fruchtbaren Blick auf ihre kooperativen Potenziale, die für die Etablierung und Stärkung digitaler Öffentlichkeiten jenseits der großen US-Plattformgiganten von entscheidender Bedeutung sind. Gleichzeitig gilt es zu berücksichtigen, dass viele der kooperativen Potenziale gerade aus einer Zusammenarbeit unter Beibehaltung unterschiedlicher Logiken erwachsen.
Mit anderen Worten: Strukturelle Diversifikation – insbesondere entlang der Unterscheidung zwischen gewinnorientierten und demokratisch beauftragten Medien – sollte nicht durch einen stärker kooperativen Ansatz aufgehoben werden. Vielmehr bildet sie die Grundlage für eine wechselseitige, auch publizistische Befruchtung. Ziel wäre demnach ein Coopetition-Ansatz, in dem kooperative und wettbewerbliche Elemente, die teilweise auch heute schon nebeneinander existieren, neu geordnet werden.
In diesem Beitrag eröffnen wir deshalb eine dahingehend neue Perspektive, indem wir bislang unausgeschöpfte Zusammenarbeit und Beiträge der öffentlich-rechtlichen Medien zu einer gelingenden Medienlandschaft ins Zentrum unserer Betrachtung rücken, sofern sie zwei Bedingungen erfüllen: a) sie stärken publizistische Vielfalt und Wettbewerb; b) sie sind im gegebenen europäischen Rechtsrahmen realisierbar.
Dafür schlagen wir einen Analyserahmen für Kooperationen vor, der die bereits erfolgte Öffnung der öffentlich-rechtlichen Medien und deren Kollateralnutzen für private Anbieter beleuchtet, ferner aber auch den Möglichkeitsraum umreißt, in welchem weitergehende Potenzialen für kooperative Beziehungen zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen Akteuren eröffnet werden können. Der Beitrag schließt mit einem Ausblick auf mögliche Aufgaben der Öffentlich-Rechtlichen in der digitalen Medienwelt des 21. Jahrhunderts.
Formen der Kooperation im Wettbewerb zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Medien
Wenn wir im Folgenden öffentlich-rechtliche Medien zum Ausgangspunkt für die Analyse von (unausgeschöpften) Kooperationspotenzialen für die deutsche und europäische Medienlandschaft insgesamt heranziehen, dann fußt diese Perspektive in ihrer konstitutiven Differenz zu privaten Medien.
Aufgrund ihrer politisch-demokratischen Beauftragung und gemeinschaftlichen Finanzierung – sei es über Rundfunkbeiträge oder Steuern – kommt ihnen eine andere Rolle und Aufgabe zu als privatwirtschaftlich organisierten Medien. Im programmlichen Bereich umfasst dies unter anderem den Auftrag, alle und nicht nur primär werberelevante Zielgruppen zu erreichen und Bildungs- und Informationsangebote zu schaffen, die marktlich nicht oder nur unzureichend finanzierbar wären.
Dieser grundsätzlich andere, gemeinwohlorientierte Anspruch an öffentlich-rechtliche Medien reicht aber über das Programm hinaus. Auch in vordigitaler Zeit hat der Medien- und Kulturstandort Deutschland von der (krisen- und konjunkturunabhängigen) Stabilität öffentlich-rechtlicher Nachfrage profitiert (vgl. die ARD Produzentenberichte, exemplarisch: ARD (2024)). Allerdings wurden und werden die mittelbar mit einem starken öffentlich-rechtlichen Anbieter und Nachfrager verbundenen Stabilitäts- und Spillover-Effekte kaum als solche anerkannt oder gar medienpolitisch gezielt befördert (vgl. Mazzucato et al., 2020; Roßnagel et al., 2023).
Eine solche gezielte Förderung von Synergien zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Medien könnte mit einer präzisierten Beauftragung von kooperativen Angeboten und Strategien verbunden sein. Aufgrund der konstitutiven Differenz zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Medienangeboten ist es auch nur logisch, hier keine symmetrische Kooperationsbeziehung, sondern durchaus auch unilateral-kooperative Angebote im Sinne einer Bereitstellung von (digitalen) Gemeingütern durch öffentlich-rechtliche Medien vorzusehen.
Dementsprechend schlagen wir vor, die Öffnung öffentlich-rechtlicher Medien für neue Formen der Zusammenarbeit mit organisationsexternen Akteuren sowie deren Beiträge zu einer demokratischen und inklusiven Medienöffentlichkeit anhand des folgenden Analyserasters zu systematisieren (vgl. Abbildung 1): Auf der x-Achse wird der inhaltliche Bezug einer Kooperation abgebildet, der zwischen infrastrukturell-technologischen und redaktionell-publizistischen Formen aufgespannt werden kann. Im Hinblick auf die publizistische Vielfalt sind Kooperationen im Bereich Infrastruktur und Technologie als weniger kritisch einzustufen als unmittelbar redaktionell-publizistische Kooperationen. Allerdings ist zu beachten, dass auch (Software-)Infrastruktur (zum Beispiel algorithmische Empfehlungssysteme) Folgen für Reichweiten und somit Auswirkungen auf die publizistische Vielfalt haben können.
Die y-Achse zeigt den Grad der Formalisierung einer Kooperation, der von unilateral-kooperativ bis hin zu beidseitig-vereinbart reicht – d.h. von einem eher offenen, ungerichteten Kooperationsangebot bis zu einem stärker geschlossenen, exklusiven Ansatz, bei dem Kooperationen zwischen den Partnern explizit ausverhandelt werden. Bei den jeweiligen Bezeichnungen handelt es sich um die Pole eines Kontinuums, innerhalb dessen auch Zwischenformen verortet werden können.
Abbildung 1: Formen kooperativer Beziehungen zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Medien mit Ankerbeispielen
– CC-BY 4.0 Christopher Buschow, Leonhard DobuschGrob lassen sich auf Basis von Abbildung 1 vier Quadranten kooperativer Beziehungen zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Medien unterscheiden: auf der technologischen Seite einerseits unilaterale (a) Infrastrukturangebote und andererseits vereinbarte Zusammenarbeit (b). Auf der publizistischen Seite (c) unilaterale Beiträge zur Stärkung des Feldes sowie (d) vereinbarte Kooperationen. Innerhalb der Quadranten erläutern wir einerseits mehrere Ankerbeispiele, die in der Abbildung abgetragen sind, und geben andererseits einen Ausblick auf den Möglichkeitsraum, in welchem künftige Potenziale für kooperative Beziehungen zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen Akteuren eröffnet werden können.
a) Infrastrukturangebote
Bei Infrastrukturangeboten öffentlich-rechtlicher Medien handelt es sich um eine unilateral-kooperative Bereitstellung von offenen Technologien zur gemeinschaftlichen Nutzung und Weiterentwicklung. In vordigitaler Zeit wäre darunter beispielsweise eine Mitnutzung von Rundfunkverbreitungstechnologien durch private Anbieter gefallen. Mit der zunehmenden Bedeutung von Softwareinfrastruktur für die Distribution und Nutzung von Medien dürfte die Relevanz dieses Feldes stark zunehmen.
Jüngstes Beispiel für ein Infrastrukturangebot von Seiten öffentlich-rechtlicher Medien ist die von ARD und ZDF verkündete Umstellung der gemeinsamen Mediathek-Entwicklung auf eine Open-Source-Basis. Im Ergebnis führt diese Strategie dazu, dass mit Beitragsmitteln finanzierte Mediatheksoftware (zum Beispiel Videoplayer, Empfehlungsalgorithmen) auch von privaten Anbietern genutzt und ggf. an eigene Bedürfnisse angepasst werden kann.
Zwar bleibt abzuwarten, ob und in welchem Ausmaß dieses Angebot tatsächlich von Privaten aufgenommen wird. Die Nutzung rechtlich verbindlicher Open-Source-Lizenzen (Harutyunyan & Riehle, 2019) stellt aber sicher, dass es dafür keiner bilateralen Einigung im Einzelfall bedarf und jedenfalls potenziell immer die Möglichkeit einer eigenständigen Weiterentwicklung – in Form eines sogenannten Forks (He et al., 2020) – offensteht.
Aufbauend auf diesen Erfahrungen ergeben sich für die Öffentlich-Rechtlichen große Potenziale, künftig eine bedeutendere Rolle in der Entwicklung und Bereitstellung digitaler Medieninfrastruktur auf Basis offener Software, offener Standards und offener Protokolle zu übernehmen (Dobusch, 2024a; 2024b). Dies könnte beispielsweise die Entwicklung von KI-Modellen sowie daten- und jugendschutzkonformer Identitätsdienstleistungen umfassen, die sodann auch privaten Medien zur Verfügung stehen würden.
Die Potenziale reichen aber auch in den Bereich Forschung und Entwicklung (F&E) hinein. Exemplarisch sei hier auf das transnationale F&E-Projekt „Public Spaces Incubator“ verwiesen. Das gemeinschaftlich von öffentlich-rechtlichen Medien aus fünf Ländern (ABC Australien, ARD und ZDF aus Deutschland, CBC/Radio-Canada aus Kanada, RTBF aus Belgien und SRG SSR aus der Schweiz) verantwortete Vorhaben entwickelt und testet Prototypen für Publikumseinbindung und -dialog jenseits von algorithmischer Polarisierung und Zuspitzung (Koban et al., 2024).
Da die Entwicklung auf Basis von offener Software und offenen Standards geschieht, stehen die Erkenntnisse nicht nur öffentlich-rechtlichen, sondern auch privaten Medien für eine Weiternutzung und -entwicklung zur Verfügung.
b) Technologische und infrastrukturelle Zusammenarbeit
Das Gegenstück zu unilateral-kooperativen Infrastrukturangeboten sind spezifische Vereinbarungen zur (Mit-)Nutzung öffentlich-rechtlicher Infrastruktur, die mit einzelnen Partnern jeweils individuell ausgehandelt werden. Beispielsweise kooperiert das ZDF im Rahmen von ZDFkultur mit Akteuren aus Kunst und Kultur in allen 16 Bundesländern und stellt diesen Kooperationspartnern die technologische Infrastruktur ihrer Mediathek für die Verbreitung von Inhalten zur Verfügung.
Der konkrete Umfang und die Art der bereitgestellten Inhalte werden mit den Kulturorganisationen jeweils einzelvertraglich vereinbart, insbesondere hinsichtlich der Lizenzen und Programmkriterien, um die rechtlichen und technischen Anforderungen zu gewährleisten (Dobusch, 2020).
ZDFkultur könnte den Ausgangspunkt bilden für eine umfassendere kooperative Plattform, auf der publizistische Vielfalt innerhalb einer gemeinsamen Infrastruktur organisiert wird (Wellbrock & Buschow, 2022). Ein solches Modell ist in den vergangenen Jahren etwa als Idee einer europäischen Medienplattform diskutiert worden, deren Prüfung auch im Koalitionsvertrag der deutschen Ampel-Regierung aus dem Jahr 2021 verankert war.
Unabhängig von ihrer konkreten Ausgestaltung (zu verschiedenen Ansätzen vgl. Rauch et al., 2024), könnte ein öffentlich-rechtlich koordinierter Aufbau und Betrieb einer gemeinsamen Plattform – in beidseitig-vereinbarter Zusammenarbeit unter anderem mit Kulturanbietern, Bibliotheken, Universitäten und auch privaten Medien – ein Gegengewicht, jedenfalls aber eine Ergänzung zu den dominanten Tech-Giganten eröffnen.
c) Stärkung des publizistischen Feldes
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat bereits in vordigitaler Zeit durch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen wichtige Beiträge zur Stärkung des gesamten publizistischen Feldes geleistet. In jüngster Zeit fungiert insbesondere funk, das junge Angebot und Content-Netzwerk der Öffentlich-Rechtlichen, als eine Art „Talentinkubator“ für die Medienbranche (vgl. Cheng et al., 2024).
funk zielt unter anderem darauf ab, noch nicht etablierte Medienschaffende zu gewinnen und ihnen die Voraussetzungen für eine qualitätsvolle, professionelle Medienarbeit zu vermitteln. Es ist üblich, dass die sogenannte Content Creator bei funk ausscheiden, sobald ihr Format den Zielkorridor der 14- bis 29-Jährigen verlässt. Funk bildet somit eine Durchgangsstation und einen Karrierebeförderer, der Medienschaffenden den Zugang zur Branche eröffnet und durch ihre Weiterqualifikation einen unilateralen Beitrag zum gesamten Feld leistet.
Das Beispiel funk verweist auf Strategien, wie sich öffentlich-rechtliche Medien durch Unterstützungsangebote für das publizistische Feld insgesamt einsetzen könnten. Eine vielversprechende Entwicklungsperspektive wären Hilfestellungen für das publizistische Wirken Dritter, denn der Journalismus ist zunehmend durch Zeitmangel, Kostensenkungen und Arbeitsverdichtung geprägt.
Neue Organisationen wie CORRECTIV.Lokal oder das Science Media Center Germany (SMC) stellen publizistische Ressourcen bereit, die jeder nutzen kann, um diesen Herausforderungen entgegenzuwirken. CORRECTIV.Lokal beispielsweise organisiert eine offene Community von mehr als 1.800 Lokaljournalisten, denen Datensätze und sog. Recherche-Rezepte zur Verfügung gestellt werden, um bundesweit relevante Themen auf lokaler Ebene weiter recherchieren zu können. Das SMC übernimmt bestimmte Schritte der journalistischen Recherche, indem es qualitativ hochwertiges „Rohmaterial“ (unter anderem Experteneinschätzungen und Daten) produziert, das der Wissenschaftsjournalismus als Grundlage für weiterführende Arbeit nutzen können (Buschow et al., 2022).
Vergleichbare Unterstützungsangebote würden öffentlich-rechtliche Medien in die Lage versetzen, journalistische Qualität und Public Value außerhalb der eigenen Organisation zu befördern und die Bedingungen für die Zukunft einer funktionstüchtigen Medienlandschaft mitzugestalten.
d) Publizistische Kooperationen
Im Rahmen des 2014 gestarteten Rechercheverbundes von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung wird seit mehr als zehn Jahren intensive Zusammenarbeit von öffentlich-rechtlichen und privaten Medien im investigativen Journalismus praktiziert. Recherchen werden gemeinsam organisiert, die anschließende Distribution erfolgt über die jeweils eigenständigen Kanäle von Privaten und Öffentlich-Rechtlichen.
Diese Formen der Kooperationen sind formal vertraglich organisiert und ermöglichen eine tiefgreifende und aufwändigere journalistische Arbeit, als sie einem Medienanbieter allein heute vermutlich noch möglich wäre.
Denkt man diese Formen publizistischer Kooperationen weiter, so läge eine Möglichkeit in der Schaffung einer Unterstützungsinfrastruktur für ein regionales Medienökosystem, insbesondere für journalistische Neugründungen. Diese könnte nach dem Vorbild von Initiativen wie dem Tiny News Collective in den USA gestaltet sein, das als Gründungsinkubator für kleine Nachrichtenorganisationen dient.
Die Unterstützung durch die Öffentlich-Rechtlichen könnte sich darauf konzentrieren, neuen Nachrichtenorganisationen den Einstieg in die Medienlandschaft mit deutlich weniger Ressourcen zu ermöglichen, sodass sich nicht jede Neugründung immer wieder denselben Herausforderungen des digitalen Publizierens stellen müsste (Buschow, 2018).
Fazit
Der vorliegende Beitrag hat die Potenziale einer kooperativen Weiterentwicklung der dualen Medienordnung unter den gegenwärtigen Bedingungen der Digitalisierung betrachtet. Öffentlich-rechtliche und privatwirtschaftliche Medien können durch neue Formen der Zusammenarbeit zur Etablierung und Stärkung digitaler Öffentlichkeiten jenseits der großen US-Plattformgiganten beitragen, ohne dabei das Prinzip ihrer strukturellen Diversifikation zur Disposition zu stellen. Die Beispiele verdeutlichen, wie kooperative Beziehungen sowohl infrastruktureller als auch publizistischer Art heute bereits in der Praxis umgesetzt werden und wie sie die Medienlandschaft in Deutschland und Europa auch insgesamt voranbringen können.
Gleichzeitig sind viele der genannten oder als möglich skizzierten Beispiele isolierte Initiativen und kein Ergebnis einer medienpolitisch bzw. -rechtlich verfolgten Strategie, die das Verhältnis von öffentlich-rechtlichen und privaten Medien kooperativ gestalten will. Voraussetzung für eine solche Strategie wäre es, die traditionell antagonistische Betrachtung des Verhältnisses von privaten und öffentlich-rechtlichen Medien durch einen Coopetition-Ansatz zu ersetzen.
In der betriebswirtschaftlichen Netzwerkforschung ist Coopetition, also das Management von gleichzeitig wettbewerblichen als auch kooperativen Beziehungen zwischen Organisationen, bereits seit den frühen 1990er Jahren etabliert (Sydow 1992; Sydow et al., 2025). Zentrale Herausforderung ist dabei, dass Spannungsverhältnisse ausgehalten und gemanagt werden müssen. Neben Wettbewerb und Kooperation gehören dazu weitere Spannungsverhältnisse wie Vertrauen und Kontrolle oder Autonomie und Abhängigkeit. Umgelegt auf die deutschsprachige und europäische Medienlandschaft ist das zentrale Spannungsverhältnis mit Sicherheit die Aufrechterhaltung oder sogar Stärkung jeweils idiosynkratischer, bisweilen sogar gegensätzlicher Logiken der Medienproduktion bei gleichzeitiger Zusammenarbeit im Bereich von Infrastruktur oder im Publizistischen.
Als besonders geeignet erscheinen uns in diesem Zusammenhang gerade unilateral-kooperative Strategien, in denen öffentlich-rechtliche Medien beauftragt werden, Leistungen für die Medienlandschaft insgesamt zu erbringen (Dobusch, 2024a). Weil diese Leistungen als einseitige Kooperationsangebote erbracht werden, sinkt der Koordinationsaufwand und verbessert sich ihre Skalierbarkeit.
Im Ausblick deutet vieles darauf hin, dass die Zukunft der Medien in Deutschland und Europa nur in kollektiver Praxis verwirklicht werden kann. Dazu müssen alle Beteiligten über ihren Schatten springen: Private Medien sollten sich von alten Grabenkämpfen verabschieden; öffentlich-rechtliche Medien wiederum sollten anerkennen, dass Public Value etwas ist, was auch außerhalb der Grenzen der eigenen Organisation entsteht und auch dort von ihnen befördert werden kann. Aus unserer Sicht sind dies wichtige Voraussetzungen nicht nur dafür, die offensichtlichen Schattenseiten monopolistischer Plattformöffentlichkeiten einzudämmen, sondern vor allem auch, um die Chancen digitaler Technologien für mehr demokratische Öffentlichkeit und Teilhabe auch zu nutzen.
Der Beitrag steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz und ist zuerst im Wirtschaftsdienst, 105(3), S. 1-5 erschienen.
Zur Quelle wechseln
Zur CC-Lizenz für diesen Artikel
Author: Leonhard Dobusch
#fernsehrat #medien #neues #offentlich #private #rechtliche #zwischen